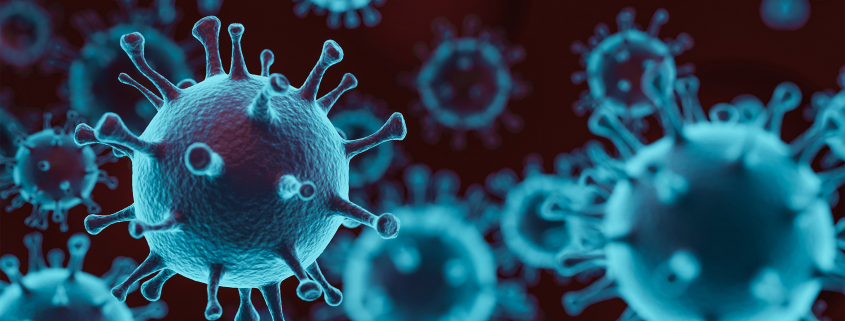Erst Covid, dann pleite!
Finanzielle Auswirkungen der Pandemie treffen freigemeinnützige Kliniken besonders hart
Noch kämpfen sie um das Überleben der COVID-Patienten. Spätestens im Sommer dann um die eigene Existenz.
Eine Insolvenzwelle rollt auf die deutschen Klinken zu. Davon sind viele Experten überzeugt. Von der Deutschen Krankenhausgesellschaft über Schleswig-Holsteins Gesundheitsminister Heiner Garg bis hin zum Verband der evangelischen Krankenhäuser: Sie alle fordern eine Nachbesserung des Rettungsschirms, der den Kliniken finanziell durch die Pandemie helfen soll. Tatsächlich wäre eine Anpassung dringend nötig: Aktuell kann nur etwa die Hälfte der Krankenhäuser in unserem Land auf diese Ausgleichszahlungen bauen. Zurzeit – denn Ende Februar könnten diese Hilfen nach aktueller Planung auslaufen.
Statt den Blick jetzt aber nur auf kurzfristige Unterstützung in der Pandemie zu richten, sollte man dringend damit beginnen, die strukturellen Probleme in aller Tiefe anzugehen. Denn eine Konsolidierung der Krankenhauslandschaft war bereits in vollem Gange, bevor der erste COVID-Patient in einer Klinik landete. Ein verbesserter Rettungsschirm – so sehr wie ihn sich wohl alle wünschen – wäre daher nur ein Tropfen auf dem heißen Stein: Eine kurze Erleichterung, aber schnell wieder verdampft.
Seit mindestens 5 Jahren beobachten wir in der deutschen Krankenhauslandschaft einen andauernden Abwärtstrend: Schon vor der Coronakrise hatte sich die wirtschaftliche Situation vieler Krankenhäuser deutlich verschlechtert und einen kritischen Punkt erreicht. Insbesondere Häuser in freigemeinnütziger und kommunaler Trägerschaft kämpfen schon länger um finanzielle Stabilität. Die COVID-Sonderfinanzierung mittels Freihaltepauschale im Sommer und kürzeren Zahlungszielen sorgte in vielen Fällen zwar vorübergehend für mehr Liquidität. Die strukturellen Probleme wurden so kurzfristig übertüncht; gelöst wurden sie aber nicht. Im Gegenteil: Über 80 Prozent der Krankenhausmanager erwarten eine weitere Verschlechterung der Situation. Das zeigen – unabhängig voneinander – verschiedene Umfragen.
Warum so viele Kliniken defizitär sind, liegt eigentlich auf der Hand.
Verschärfte Regulatorik setzt die Krankenhäuser im operativen Geschäft zunehmend unter Druck. Immer strengere und kostentreibende Vorgaben zu Personaluntergrenzen und Strukturvoraussetzungen für bestimmte Leistungen machen es den Kliniken nicht leicht, Rücklagen zu erwirtschaften. Hinzukommt der Druck, den die Kostenträger über den Medizinischen Dienst (MD) auf die Kliniken ausüben. Dabei darf man nicht vergessen, dass die Kliniken bereits seit längerem einen schweren Rucksack mit sich herumtragen: Da die Länder ihren Investitionspflichten nur teilweise und sehr unterschiedlich nachkommen, hat sich in den deutschen Krankenhäusern allein in den letzten rund zehn Jahren ein Investitionsstau von insgesamt rund 30 Mrd. Euro aufgebaut.
Allein schon um die bestehende Infrastruktur und Ausstattung kontinuierlich zu ersetzen, bräuchten die Krankenhäuser eine jährliche, stabile EBITDA-Quote von rund vier Prozent. Will man mit dem Fortschritt mithalten und sein Haus zukunftssicher aufstellen, wären – um anstehenden Investitionen u.a. in Digitalisierung vorzunehmen – sogar rund sechs Prozent notwendig. Ein Ziel, das Krankenhäuser in freigemeinnütziger und öffentlicher Trägerschaft nur sehr schwer erreichen können: Sie liegen seit Jahren unter diesen Werten – und die Lage spitzt sich tendenziell immer weiter zu. Während aber bei kommunalen Kliniken die Landkreise und Kommunen Finanzierungslücken – im Rahmen der zulässigen Wettbewerbsregelungen – oft auch langfristig aus dem öffentlichen Haushalt schließen können, stehen die freigemeinnützigen Häuser in der Regel schlechter da: Nur wenige Träger können es sich leisten, Defizite dauerhaft auszugleichen.
Welche Möglichkeiten haben Krankenhausträger und – manager, eine drohende Insolvenz abzuwenden? Wer sich frühzeitig die Frage stellt, ob sein Haus wirklich zukunftsfähig ist, kann rechtzeitig reagieren und notwendige Sanierungsmaßnahmen einleiten. Schließungen und Zusammenlegungen von Fachabteilungen oder gar Standorten, Verbesserung operativer Prozesse wie Verweildauer, Belegungs- und OP-Management, Kodierung und Erlössicherung sind dabei wichtige Ansatzpunkte. Aber auch Sachkostenoptimierungen und eine Überprüfung des Personaleinsatzes tragen dazu bei, Erlöse zu steigern und Kosten zu senken. Zudem sollten Investitionen, vor allem auch baulicher Art, kritisch hinterfragt werden.
Es lohnt sich – insbesondere für freigemeinnützige Träger – auch über Zusammenschlüsse und strategische Allianzen nachzudenken. Durch eine koordinierte Umsetzung der oben genannten Sanierungsmaßnahmen können aufeinander abgestimmte Behandlungsangebote entstehen und zugleich Synergieeffekte genutzt werden. Die Versorgung der Bevölkerung im Einzugsgebiet wird dadurch sichergestellt; gleichzeitig können Kosten- und Effizienzvorteile realisiert werden.
Aber auch wenn sich die Insolvenz nicht mehr verhindern lässt, bedeutet das nicht zwangsläufig das Ende:
Das Insolvenzrecht selbst beinhaltet Instrumente für eine geordnete Sanierung der Häuser mit der Option auf eine langfristige Überlebenschance. Bereits seit einigen Jahren nutzen Krankenhäuser immer öfter z.B. eine Insolvenz in Eigenverwaltung, um eine dringend notwendige Sanierung voranzutreiben. Mit dem zu Beginn des Jahres in Kraft getretenen Gesetzes über den Stabilisierungs- und Restrukturierungsrahmen für Unternehmen (StaRUG) wurde jetzt ein zusätzliches Instrumentarium geschaffen, um auch außerhalb einer Insolvenz präventiv und diskret Sanierungsmaßnahmen durchzuführen und das Unternehmen von gegen sich gerichteten Forderungen zu entlasten. Wer ein Risikofrüherkennungssystem aufgebaut hat und die eigene Liquiditätsentwicklung fortlaufend im Blick behält, bei dem werden rechtzeitig die Alarmglocken schrillen: In den meisten Fällen lässt sich eine Schieflage dann noch überwinden. Ein Verkauf oder gar die Schließung eines Krankenhauses kann noch abgewendet werden.